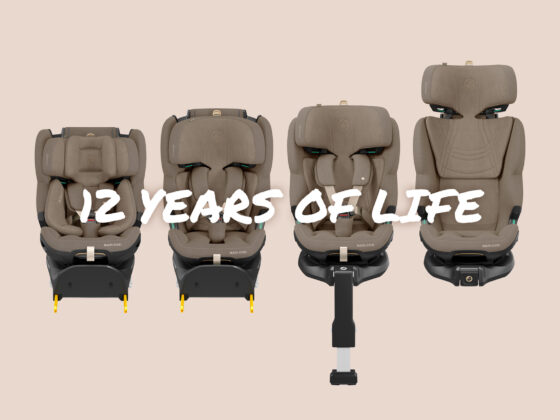Ein Überblick über die frühkindliche Entwicklung
Kinder sind von Natur aus forschende kleine Wesen. Sie lieben es, sich selbst auszuprobieren und die Welt zu erkunden. Daher beginnen sie auch früh, ihren Kopf einer Geräuschquelle zuzuwenden, alles in den Mund zu stecken und Laute nachzuahmen.
Die Entwicklung ist von körperlichen, seelischen, geistigen Erbanlagen und der Reife des Körpers beeinflusst. Kindgerechte Anregungen vonseiten der Bezugspersonen und aus der Umgebung sowie die gesammelten Erfahrungen nehmen darüber hinaus großen Einfluss auf die frühkindliche Entwicklung. Aus diesem Grund sollten Eltern ihrem Kind ein entwicklungsförderndes und sicheres Umfeld bieten, ihnen ausreichend Zeit schenken und passende Spielimpulse setzen.
Am besten klappt das Lernen nämlich, wenn die „Großen“ verstehen, was die „Kleinen“ gerade interessiert.
Sprechen lernen
Ein Neugeborenes drückt sich erst einmal durch Schreien aus, doch schon mit etwa drei Monaten beginnen Babys, spontan Laute zu bilden. „Oh“ und „uh“ purzeln unbewusst aus dem Mund, werden zu Lallmonologen (6 bis 12 Monate) und nach und nach für kleine Gespräche eingesetzt.
Wenn Mama oder Papa auf dieses kindliche Tönen mit einem „ooohhh“ antwortet, strahlt das Kind und wird vermutlich hochmotiviert mit einem „oh-oh“ antworten. So ein dialogisches Handeln dient übrigens nicht nur der Sprachentwicklung, sondern ist auch für das Sozialverhalten wichtig.
- Wenn ein Baby beispielsweise durch seine Laute Müdigkeit verrät, sollten Eltern diesen Zustand in etwa so kommentieren: „Da ist ja jemand müde!“ Auf diese Weise bekommt das Kind ein Wort für seine Befindlichkeit, und auch wenn es zunächst noch nicht selbst ausgesprochen werden kann, wird diese Empfindung sprachlich richtig verknüpft. Eltern, die ihren Kindern also die passenden Worte „in den Mund“ legen, unterstützen sie wunderbar dabei, ihren Wortschatz zu erweitern, um später vielen verschiedenen Gefühlen und Eindrücken Ausdruck verleihen zu können.
Nonverbale und verbale Kommunikation
- Kinder versuchen sehr früh, Blickkontakt zu halten, und lächeln andere Menschen an. Anfangs unterscheiden sie dabei noch nicht zwischen Fremden und Bekannten.
- Das tun sie erst im Alter von etwa neun Monaten: Dann beginnen Babys zu „fremdeln“ und lassen sich nur unter Protest von Unbekannten auf den Arm nehmen. Diese Unterscheidungsfähigkeit ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Sozialverhaltens.
- Etwa mit neun Monaten wird aus dem frühkindlichen Lallen auch ein längeres Vokalisieren vornehmlich auf A-Lauten („Wa – wa – ra – ra“). Daraus werden dann Silbenverdoppelungen gebildet, die schließlich – meist im Alter von neun bis zwölf Monaten – zu den zwei wohl schönsten Wörtern führen: „Mama“ und „Papa“. In der Folge wird die verbale Kommunikation deutlich intensiver.
- Mit etwa eineinhalb Jahren verwenden Kinder bereits Wortkreationen der Symbolsprache, um zu plaudern. Der Hund wird zum „Wau-Wau“, das Essen zu „Nam-Nam“ und das Auto zum „Tut-Tut“. So kann man sich doch schon recht gut unterhalten, oder? In dieser Phase der Babysprache sollten Eltern trotzdem immer wieder auch in ganzen Sätzen mit ihren Kindern kommunizieren. Forschungen zur Sprachentwicklung zeigen nämlich, dass sinnvolle und ganze Sätze die Sprachentwicklung und Lerngeschwindigkeit von Kindern begünstigen.
- Rund um den zweiten Geburtstag plaudern viele Plappermäulchen dann bereits in Zwei- und Mehrwortsätzen und haben ihren Wortschatz deutlich erweitert. Sie haben den erklärten Meilenstein erreicht und machen ihre Eltern vor Staunen sprichwörtlich sprachlos.
Motorische Entwicklung
Kinder überwinden Hindernisse, die im Verhältnis zu ihrem Körper unfassbar hoch sind, verschieben Gegenstände, die im Wettkampfsport weit über ihrer Gewichtsklasse liegen würden, und ziehen sich wie Topathleten an Möbeln hoch. Was die Entwicklungsgeschwindigkeit des Erwerbs von Bewegungskompetenz und Beweglichkeit betrifft, ist die zeitliche Spannbreite freilich groß. Manche Kinder sind motorisch sehr früh aktiv, andere rollen das Feld später im Laufschritt von hinten auf.
Die motorische Entwicklung ist neben körperlichen Voraussetzungen von Geschicklichkeit, Balance und Koordination sowie von äußeren Faktoren abhängig. Eltern mit einem stabilen Nervenkostüm sind da sehr förderlich. Schließlich wird das Kind auf seiner Entdeckungsreise hinfallen, sich schmutzig machen und sich oft unendlich viel Zeit lassen. Klar wäre man mit dem Kinderwagen deutlich schneller unterwegs als mit einem Kleinkind, das einen Minischritt vor den anderen setzt, nebenbei noch Schnecken beobachtet und in Pfützen hüpft. Doch am Ende des Weges wird eben dieses Kind weit kommen. Denn Bewegung bringt uns nicht nur von A nach B, sondern bewirkt auch geistiges Weiterkommen.
Schon Neugeborene kann man dabei beobachten, wie sie ihren kleinen Körper aktivieren. Sie robben nach der Geburt zur mütterlichen Brust hoch, um Muttermilch zu bekommen. Aber sie strampeln auch, rudern mit é„rmchen wie Beinchen, und urplötzlich drehen sie sich zur Seite. Das passiert gleichsam über Nacht. Daher sollte man ein Baby auch niemals unbeaufsichtigt auf dem Wickeltisch oder dem Rand des Elternbetts liegen lassen. Denn wenn der „Move“ zur Seite erst einmal geschafft ist, ist es auch mit dem Umdrehen vom Bäuchlein auf den Rücken nicht mehr weit. Umgekehrt gelingt es vermutlich auch noch im ersten Lebenshalbjahr.
Freihändig sitzen
Bereits im Alter von etwa drei Monaten beginnen Babys, sich auf den Unterarmen abzustützen und ihren Kopf zu heben. Das ist nicht einfach, weil der Kopf ein megaschwerer Körperteil ist und die Balance verlorengeht, wenn er nach vorne kippt. Um sitzen zu können, muss er in der Rumpfebene gehalten werden können. Das klappt bei vielen Kindern nach rund einem halben Jahr. Im Alter von zehn Monaten können Kinder frei und ohne jeden Moment umzufallen sitzen. Ein Grund zu feiern, denn ab jetzt kann endlich mit beiden Händen gespielt werden!
Krabbeln – Stehen – Gehenlernen
Ein großer Entwicklungsschritt ist das Gehenlernen. Der Weg dorthin führt über viele kleinen Zwischenschritte, und die meisten Kinder gehen ihn über das Krabbeln an. Manche machen es unkonventioneller und schieben sich rücklings oder rollen über den Boden.
Rund um den ersten Geburtstag (9 bis 15 Monate) ziehen sich Krabbelkinder an Möbeln, Tisch- und Menschenbeinen hoch, um zumindest einen kleinen Moment zu stehen. Kurz frei stehen zu können ist dann das nächste Highlight. Wie gut, dass die Windel den Popo weich abfedert! Denn die unermüdlichen Versuche enden anfangs oft am Boden. Mit eineinhalb Jahren können gesunde Kinder ohne Hilfe gehen und bewältigen mühelos auch Unebenheiten auf Waldböden und am Kinderspielplatz.
In den ersten Lebensjahren lernen kleine Menschenkinder so viel wie nie wieder in ihrem ganzen Leben. Sie leben ihre Stärken aus und lernen ihre Schwächen kennen. Unermüdlich überwinden sie kleine und große Stolpersteine und legen nicht jedes Wort auf die Goldwaage, wenn sie sprechen lernen. Und sie haben etwas gemeinsam: Sie tun es einfach und bleiben dran, komme was wolle. Mutig, unermüdlich und neugierig. Da könnten sich so mancher Erwachsene ein Scheibchen abschneiden!
Wann wird es leichter mit dem Baby?
Viel Lärm um nichts … oder ist das erste Jahr mit einem Kind wirklich so anstrengend, wie viele es beschreiben? Wir haben Mütter gefragt, nach entwicklungspsychologischen Erklärungen gesucht und – aus guten Gründen – Tipps für diese Zeit zusammengesucht.
Schlafentzug
„Der Schlafentzug ist das allerschlimmste.“ Darüber sind sich die meisten Mütter einig.
Wann das Baby durchschläft und längere Verschnaufpausen gewährt, ist von vielen Faktoren abhängig. Zudem wird eine Frau, die vor der Geburt ihres Kindes mit fünf Stunden Schlaf auskam, schneller das Gefühl haben, wieder schlafen zu können, als eine, die sich blauäugig bald wieder acht Stunden ungestörter Nachtruhe erträumt hat.
Erstaunlicherweise muss etwas so Selbstverständliches wie Schlafen von Neugeborenen aber erst erlernt werden. Entwicklungspsychologisch betrachtet gelten Babys in ihrer Fähigkeit, sich selbst zur Ruhe zu bringen, in den ersten drei Lebensmonaten als unreif und sind daher auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen. Erst allmählich können sie sich alleine „ausknipsen“, also auch einschlafen, ohne gestillt, geschaukelt oder gar getragen zu werden.
Exzessives Schreien oder massive Schlafstörungen fallen dagegen unter die Diagnose „frühkindliche Regulationsstörungen“, die nur für die ersten drei Lebensjahre gestellt wird. Danach sollte der Spuk tatsächlich zu Ende sein oder eine andere Ursache (z. B. Angststörung) dafür verantwortlich gemacht werden.
Die erste Zeit mit dem Baby
Sind es anfangs meist die ganz normale kindliche Entwicklung und die häufigen Mahlzeiten, die die Nachtruhe unterbrechen und so den Alltag fordernd gestalten, ziehen bald Blähungen und das Zahnen viel Aufmerksamkeit auf sich. Jeder abgehende Pups löst bei Eltern Begeisterungsstürme aus, und jedes Zähnchen, das sich durch den harten Kiefer schiebt, ist ein Segen.
„In der Zeit des Zahnens schwankte ich permanent zwischen Mitleid mit dem Baby und Selbstmitleid. Kein Wunder, traten doch die vier oberen Vorderzähnchen alle gemeinsam heraus. Die vergangenen drei Jahre waren wohl die härtesten meines Lebens“ erzählt eine Mutter.
Sie wird dafür mit einem Kinderlachen belohnt, bei dem schon ganz schön viele Milchzähnchen zu sehen sind.
Unterstützung
„Unser erster Meilenstein war das Abstillen. Damit habe ich eine große Portion Eigenständigkeit zurückgewonnen. Nicht mehr die einzige und unentbehrliche Nahrungsquelle zu sein, hat nach fast einem Jahr wirklich gutgetan. Ich würde jeder Mutter empfehlen, spätestens dann auch mal wieder ohne Kind ein paar Stunden fortzugehen.“
Doch loszulassen und den Schatz jemand anderem anzuvertrauen ist für manche keine leichte Übung. Am besten klappt es wohl, wenn man ihn in guten Händen weiß. Wer nicht das Glück eines unterstützenden Partners oder lieber Großeltern hat, sollte früh damit anfangen, sich ein Netzwerk aufzubauen. Tagesmütter, Leihomas oder Babysitter sind natürlich mit Kosten verbunden. Doch man kann sich auch mit ein oder zwei anderen Müttern zusammentun, in einer Rochade abwechselnd auf alle Kinder schauen, um dazwischen von freier Zeit zu profitieren.
Eltern-Kind-Treffen, Krabbel- oder Stillgruppen, bei denen in gemütlicher Runde geplaudert oder Trost gespendet wird und man sich austauscht, sind in der ersten Zeit ebenfalls oft ein wichtiger Anker.
Das Naseputzen…
Wenn die Kleinen die ersten Schritte machen, geht’s plötzlich fast wie von selbst. Die Messlatte liegt genau genommen also gar nicht allzu hoch. Aber wer freut sich nicht wie über einen Lottosechser, wenn die lieben Kleinen sich endlich alleine schnäuzen können? Wie gut, dass ich das auch schon kann … Mir kullern nämlich die Tränen der Rührung über die Wangen, wenn ich an die vielen zauberhaften Dinge denke, die Kinder nun tagtäglich lernen, ausprobieren, plötzlich können und uns mit viel Liebe zurückgeben.
Autor:in:
Katharina Wallner ist frei praktizierende Hebamme, Pädagogin und unterrichtet an der Fachhochschule Campus Wien am Studiengang Hebammen. Sie begleitet Familien von der Schwangerschaft bis ins Kleinkindalter. Aktuelle Artikel